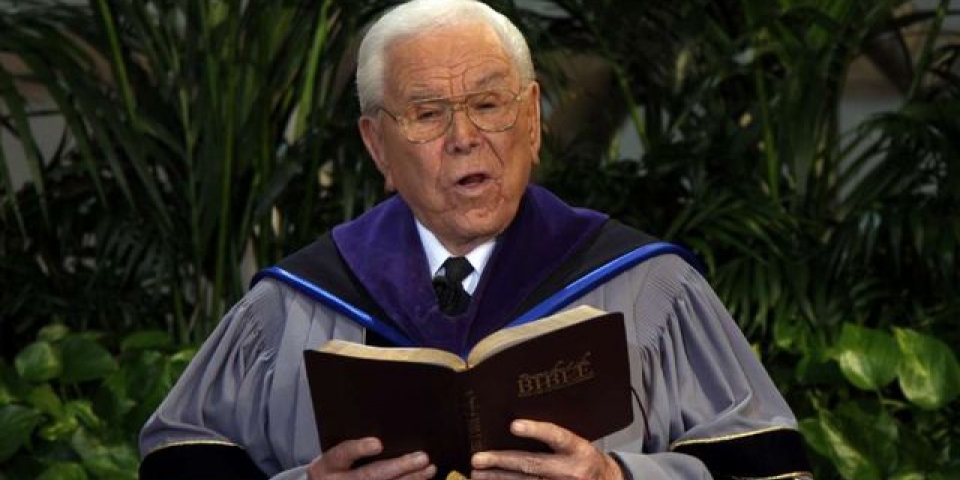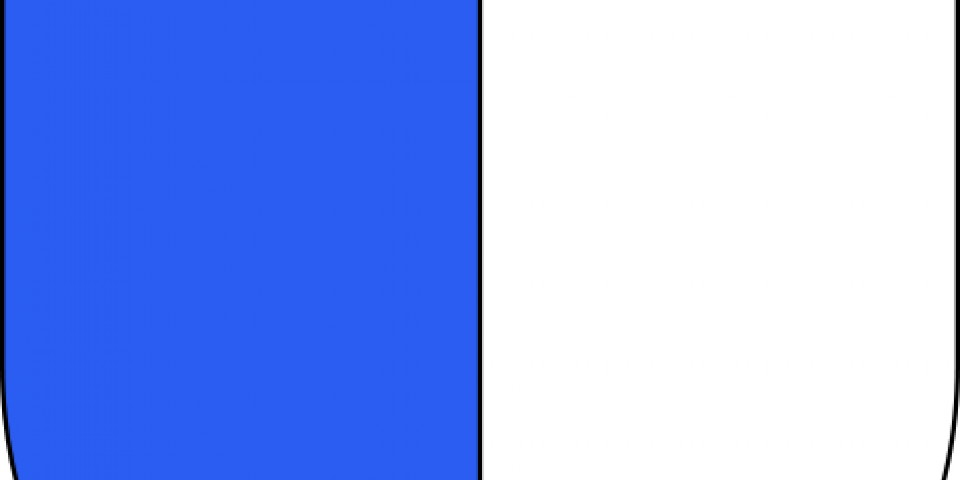Der Mann an seiner Seite war schlecht gelaunt. Als Polizist war er zwar gewohnt, zu jeder Zeit bereit zu sein. Aber dass er ausgerechnet heute, am Heiligen Abend, da er eigentlich mit seiner Familie um den Christbaum sitzen wollte, sich mit diesem widerlichen Gesellen in Wind und Wetter herumschlagen musste, das konnte er nicht verschmerzen. Es war wahrhaftig auch kein Vergnügen gewesen, um diese Jahreszeit tagelang da oben im unwirtlichen Alpengebiet herumzupirschen, bis er und ein Amtskollege den Gesuchten endlich in einer verlassenen Alphütte aufgefunden hatten. Natürlich hatte er sich nicht ohne weiteres in sein Schicksal ergeben, und es war ein Glück, dass sie der geladenen Schusswaffe früh genug habhaft werden konnten, bevor das Unglück geschah. Jetzt, nachdem sein Amtskollege seine Füsse schon in die warmen Hausschuhe stecken konnte, verblieb ihm die "Ehre", den Häftling noch die letzte Wegstrecke zum Arrestlokal der Gemeinde zu bringen. Nachdem der Beamte die Kleider des Häftlings nochmals gründlich durchsucht und ihm die gebundenen Hände gelöst hatte, wies er mit einer kurzen Handbewegung auf die harte Strohpritsche, die nebst einem massiven steinernen Tisch den einzigen "Komfort" dieses Raumes bildete. Kurz darauf entfernte er sich. Zwei-, dreimal kreischte der grosse Schlüssel im Schloss, dann war es still. Der Mann im dunklen Keller des Gemeindehauses war nun allein. Todmüde wie er war warf er sich auf den harten Strohsack und starrte mit brennenden Augen auf die gegenüberliegende Wand, wo sich als einziger Lichtpunkt eine kleine Helle abzeichnete, die von der Strassenlampe her durch das kleine vergitterte Fenster brach. - So, da sass er nun also, sie hatten ihn gepackt, und was nun weiter mit ihm geschehen würde, konnte er sich an den Fingern abzählen. Er durfte nun diese Nacht in dieser feuchtkalten Bude hungern und frieren, und morgen würde man ihn weiterbefördern, in die Kantonshauptstadt, und dort durfte er dann hinter Schloss und Riegel weiterkuren. Oh, er kannte das, es war schliesslich nicht das erste Mal, dass er in die Hände der Polizei geraten war. Diesmal hätte es ihm nicht mehr passieren sollen. Er hatte gehofft, noch einmal dem Arm der Gerechtigkeit zu entwischen, der Justiz, die wieder nach ihm fahndete, ein Schnippchen zu schlagen und ins Ausland zu verschwinden. Nun hatte es ihm gefehlt - Dummkopf, der er war. - Eine ungeheure Wut erfasste ihn. Wut über sich selber und seine Unvorsichtigkeit, Wut über die Polizei, Wut über diese Mauern, die ihn nun einschlossen und an seinem Vorhaben hinderten. Das vergitterte Fenster da oben, die verrammelte Türe - alles machte ihn rasend. Nur an seine Schuld, die ihn hier hereingebrachte hatte, an die dachte er nicht. Er war auch weit davon entfernt, darüber nachzugrübeln, ganz andere Probleme wälzte er in seinem Hirn. Aus dieser verwünschten Bude heraus wollte er um jeden Preis. Aber nichts fand sich hier, womit er das Eisengitter dort oben oder die verriegelte Tür hätte zertrümmern können. Sogar sein Sackmesser und das letzte Zündhölzchen hatten ihm die grünen Hunde abgenommen. Von seiner aussichtslosen Lage rasend gemacht, sprang er auf. Mit seinen Schuhen schlug er gegen die verriegelte Türe. Seine Fäuste schlug er sich an den harten Mauern wund. Er wollte hinaus, hinaus. Wie ein Rasender durchmaß er die Zelle. Flüche und Verwünschungen schrie er in die Dunkelheit. Aber rings um ihn blieb alles totenstill. - Doch plötzlich hörte er Stimmen. Die Geräusche vieler Schritte im Raume über ihm. Lachen, Schwatzen, Stimmengewirr. Nein, das waren nicht Menschen, die eigens daherkamen, um sich um einen verrufenen Häftling zu kümmern, das wusste er. Trotzdem schrie er weiter Flüche und Verwünschungen aus, mochten sie es hören, desto besser. Doch niemand schien sich darum zu kümmern. Eine Weile noch ging über ihm das Hin und Her - dann erklang der Anfang eines Liedes. Das hatte gerade noch gefehlt. Ihm stand hier unten in seinem verwünschten Loch der Sinn wahrhaftig nicht nach Gesang. Er fing aufs neue an zu fluchen und zu toben, seine Schuhe bearbeiteten die schwere Eisentüre, dass es nur so dröhnte. Der Gesang ging weiter, wurde in gewissen Abständen wiederholt. Das war für den Mann im dunklen Keller zu viel, es war einfach nicht mehr zum Aushalten. Er warf sich auf das harte Lager und presste die geballten Fäuste an die Ohren; er wollte nichts mehr hören, nichts mehr. Aber es half nichts. Wie auf geheimen Befehl drangen die Töne bis in sein Innerstes, wühlten dort und bohrten. Stöhnend lag der Mann auf seiner Pritsche, rettungslos dem Tumult seiner hasserfüllten Gedanken preisgegeben. Plötzlich aber horchte er auf, ein Lauschen kam in seine verzerrten Züge, seine verkrampften Hände lösten sich. - Halt, das war doch - dieses Lied da oben. - Der Mann lauschte jetzt angestrengt. Irgend etwas Vertrautes schwebte in der Luft, hatte ihn gepackt, ergriffen. Diese Melodie kam immer näher, je stiller der Mann in seiner Zelle wurde. Was war denn das - war das nicht? - diese Melodie musste er doch kennen. - Nein, dummes Zeug, er hatte jetzt anderes zu tun, als sentimentalen Liedern nachzusinnen. Wenn es ihm nur gelänge, hier herauszukommen, dem verhassten Grünfrack ein Schnippchen zu schlagen. Er könnte sich dann am Morgen in der leeren Zelle seine Nase breit drücken und die fade Wassersuppe selber auslöffeln. - Jetzt, schon wieder diese Melodie - wollten sie denn nicht aufhören da oben? Aber eigenartig war es doch mit diesem Lied, er musste es doch kennen - war das nicht? - Herrgott, das war ja ein Weihnachtslied, ganz richtig, jetzt hatte er es. Er selbst hatte es auch schon gesungen, in der Schule natürlich - nein, in der Kirche. Ja, richtig, in der Kirche unterm Weihnachtsbaum war es. Da war doch die Schulweihnacht, auf die er sich immer so gefreut hatte, der Lichterbaum, wie im Märchen war es ihm immer vorgekommen. Und wenn er heimkam nach der Feier, da hatte die Mutter immer einen schönen grossen Lebkuchen für ihn bereit, das war ihr Weihnachtsgeschenk - und frohe Weihnacht, stand mit weißer Zuckerschrift darauf geschrieben. Einen eigenartigen Zauber hatte dieser Lebkuchen immer in sein ärmliches Kinderleben hineingetragen. Seit wann hatte er eigentlich keinen Lebkuchen mehr genossen? - Doch jetzt Schluss mit den törichten Gedanken, morgen musste er einfach versuchen, hier herauszukommen. Es musste ihm gelingen, gleich um welchen Preis. Doch die Melodie war einfach da - und er musste lauschen, ob er wollte oder nicht. Deutlich verstand er jetzt auch die immer wiederholten Worte: "Heilige Nacht, o gieße du Himmelsfrieden in dies Herz ... Der Mann lachte ein trockenes, bitteres Lachen. War wohl dieser salbungsvolle Vers auf ihn gemünzt? Was sollte er damit anfangen? Er konnte mit diesem kein Loch in diese verfl... Mauer schlagen. Seinetwegen konnten sie jetzt Schluss machen da oben. Aber es liess ihm keine Ruhe. Wieso sangen sie jetzt dieses Lied? Es war doch noch nicht etwa Weihnachten? Er hatte in der letzten Zeit auf seiner abenteuerlichen Flucht natürlich jede Zeitrechnung, jeden Begriff über Tage und Wochen verloren. Der Mann dachte nach, er begann zu zählen, von jenem Tag an, da er wieder schuldig geworden war. Die unsteten Tage seines Umherirrens in den Bergen versuchte er zu ordnen, immer wieder von vorne beginnend. Aber die Rechnung stimmte, sie stimmte ganz genau, heute war der 24. Dezember - Heiliger Abend -, und wahrscheinlich war da über ihm irgend ein Chor mit der Einübung des Weihnachtsgesanges beschäftigt. - Heilige Nacht war es - und er, er sass hier an einem wildfremden Ort hinter Schloss und Riegel, verachtet, verfemt. Herrgott, wenn das seine Mutter wüßte! Nicht daran denken, nur das nicht - es hatte so wie so alles keinen Wert mehr, die Mutter war tot. Sie habe sich über ihren ungeratenen Sohn zu Tode gegrämt, sagten die Leute. Arme Mutter - an ihrem Sterbebett hatte er ihr versprochen, ein besseres Leben zu beginnen. Voll guten Willens war er damals gewesen - und dann? Stöhnend vergrub der Mann den Kopf in die Hände. Kein Mensch hatte damals seinem guten Willen Glauben geschenkt, und seit seine Mutter nicht mehr war, hatte sich nie mehr jemand um ihn gekümmert. Einen Vater hatte er nie gekannt, es lag ein Makel über seiner Geburt. So hatte er bald seinen schlimmen Lebenswandel wieder aufgenommen, hatte die Mutter und sein Versprechen vergessen. Nun war er wieder schuldig geworden. Aber er war weit davon entfernt, das Abscheuliche seiner Tat zu bereuen. Nur dass er sich heute hatte erwischen lassen, das konnte er sich nicht verzeihen. Wie ein lächerlicher Anfänger hatte er sich benommen, sonst wäre er schon längst über die Grenze. Statt dessen sass er nun wieder - für ein Jahr oder mehr würde es ihm diesmal sicher langen, das konnte er selber ausrechnen. Warum hatte er dort oben in der Berghütte nicht die Waffe gegen sich selbst gerichtet, anstatt auf seine Verfolger? Das wäre der einzige, der letzte Ausweg gewesen - aber dazu war er zu feige gewesen. Wenn nur das Geleier da über ihm endlich verstummen würde, er hatte es satt, es machte ihn rasend - er hielt es einfach nicht mehr aus. Mit geballten Fäusten raste er durch die Zelle, um sich dann wieder wie ein waidwundes Tier auf sein hartes Lager zu werfen. Es half alles nichts, die Melodie war da, kam immer näher. Wie in einem Film gaukelten Bilder an ihm vorüber, Bilder aus der Jugendzeit, die Christbaumfeier in der Kirche - die Mutter, ein Lebkuchenherz, frohe Weihnachten, stand darauf geschrieben, mit weißer Zuckerschrift. Der Gesang über ihm ging weiter, wiederholte sich: Bring dem armen Pilger Ruh, holde Labung seinem Schmerz... Zusammengesunken sass der einsame Mann auf seiner Pritsche mit geschlossenen Augen. Er musste lauschen, ob er nun wollte oder nicht. Genau die gleichen Worte, die gleiche Melodie wie einst war das. Etwas Vertrautes war zu ihm in die düstere Zelle gekommen. Der Mann merkte nicht, wie er mit brüchiger Stimme versuchte, die Melodie mitzusummen. Er merkte auch nicht, wie ihm dabei die Tränen unaufhörlich über das Gesicht liefen und sich in den Bartstoppeln verloren. Wie eine Mutter hatte ihn jetzt das Lied in die Arme genommen. Wie viele Jahre war es eigentlich schon her, seit jenem Weihnachtsabend, da er als Knabe dieses Lied mitgesungen hatte? Und wann war er das letzte Mal in der Kirche gewesen? Er wusste es nicht. An jenem Christabend, das wusste er noch, hatten sie ein kleines Krippenspiel aufgeführt, und er hatte dabei den Joseph darzustellen. Wie stolz war er auf diese Würde gewesen. Und heute - einen schönen Joseph würde er heute abgeben - hier, hinter Schloss und Riegel, das Christkind würde sich wohl bedanken dafür! Ja, herrlich weit hatte er es gebracht, das musste er bekennen. - Neben der Mutter war er dann durch den Schnee heimzu gestapft, das Päcklein unter den Arm geklemmt. An der Hand hatte ihn die Mutter geführt - sie hatte immer so warme Hände, die Mutter. Und dann zuhause der Lebkuchen. Das war einmal, Schluss jetzt damit. Der Mann lachte ein rauhes, bitteres Lachen. Heute war er auch durch den Schnee gestapft, aber nicht an der Hand der Mutter - gebunden hatte man ihn, wie einen Verbrecher. - Ja, was war er denn eigentlich anderes? War er denn nicht zum Verbrecher geworden? Seine fortwährenden Delikte, zuerst die kleinern, dann immer grössere, und jetzt zuletzt das Schreckliche, war das kein Verbrechen? Und hatte er nicht heute die Schusswaffe gegen einen Menschen erhoben? Was, wenn ihm das Entsetzliche gelungen wäre...? Wie ihn die Gedanken peitschten und quälten. Warum auf einmal? Hatte er sich je einmal ernstlich Gedanken gemacht über seine Verworfenheit? Nie! - Aber jetzt war es auf einmal, als ob jemand in seinem Innern an einer Türe rüttelte, sie aufreissen wollte. Ein furchtbarer Kampf tobte in ihm. Er war ihm wehrlos ausgeliefert, fand keinen Ausweg mehr aus seinem Gedankenchaos. Überall, wohin er sich wandte, stand seine Schuld vor ihm, und er wusste plötzlich, dass er die nicht abschütteln konnte, mochte er auch der Strafe entrinnen - die Schuld war da und würde ihn verfolgen und flöhe er auch bis ans Ende der Welt. Längst war über ihm der Gesang verstummt, die Christglocken verklungen, er hatte es nicht beachtet. Durch das kleine Eisengitter stahl sich schon das erste Grau des werdenden Tages, als er sich endlich zu einem klaren, ehrlichen Entschluss durchgerungen hatte. Es war die längste Nacht in seinem Leben, und sie hatte ihm nichts erspart. Jetzt aber wusste er, es gab nur einen Weg für ihn, er musste sich offen zu seiner Schuld bekennen und die wohlverdiente Strafe auf sich nehmen. Das war nicht leicht, aber diese Nacht hatte ihm unbarmherzig die Verworfenheit seines bisherigen Lebens aufgedeckt - es gab keinen Weg vorbei, die Schuld stand davor, und er musste sie sühnen. Das Lied der Heiligen Nacht hatte ihn besiegt. Als am Morgen der Polizist die schwere Tür öffnete und eintrat, war er erstaunt über die ruhige Haltung seines Häftlings. Er hatte einen neuen Wutausbruch erwartet und sich dagegen gewappnet. Durch seine verschiedenen Erfahrungen in seinem Beruf belehrt, liess er keine Vorsicht ausser acht, als er ihm das Frühstück vorsetzte. Scharf beobachtete er jede Bewegung, doch nichts geschah. Dann zog er mit einem verlegenen Räuspern ein grosses Lebkuchenherz aus der Tasche und legte es auf den grauen Tisch: "Hier schickt Ihnen meine kleine Tochter einen Weihnachtsgruss. Wir haben sie nämlich dazu erzogen, dass sie jedes Jahr mit einem ihrer Weihnachtsgeschenke jemandem eine Freude bereitet - und, ja, dieses Jahr hat sie nun Sie dazu auserkoren." - Aber was war das? Der Häftling vor ihm rührte sich nicht, er starrte nur unentwegt auf die Gabe vor ihm, auf dieses Lebkuchenherz mit der Zuckerschrift - bis ein trockenes Schluchzen seinen Körper wie im Fieber schüttelte. Jetzt war der stramme Polizist am Ende seiner Weisheit angelangt. Er hatte in seinem Beruf weiss Gott schon Verschiedenes erlebt - Wutausbrüche, hinterlistige Überfälle, Schlauheit, Trotz -, gegen all das wäre er gewappnet gewesen. Aber dies hier - nein, er wusste sich nicht zu helfen, seine ganzen beruflichen Kenntnisse halfen ihm nichts, versagten. Hier musste etwas geschehen sein, das über sein Verstehen ging. Doch, ein warmes menschliches Gefühl, das sonst in seinem Beruf keinen Platz hatte, kam ihm zu Hilfe und wies ihm den rechten Weg. - Es war ein ernstes Gespräch, das die beiden Männer zwischen den dunklen Kellermauern führten. Es wurde nichts beschönigt, nichts entschuldigt, und es stand fest, dass die Schuld gesühnt werden musste. Nachher aber, und das wurde ebenfalls festgelegt, kam der Weg in die Freiheit, und den würde er nicht allein gehen müssen. Denn der Mann da, dem er seine ganze Lebensgeschichte anvertraut hatte, würde ihm beistehen, ihm behilflich sein, und zwar dann nicht mehr als Polizist, sondern als Mitmensch! Entnommen aus ‚Im Schatten der Küpfenfluh - Gesammelte Erzählungen', ©1978 by Agnes Engel-Reich.
Datum: 21.11.2002