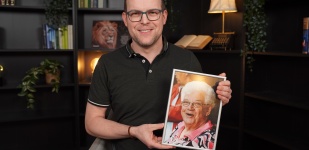Ein Theologieprofessor gegen den Trend
Die Kirchen haben sich schon längst auf permanent abnehmende Mitgliederzahlen eingestellt. Gegenläufige Trends wie etwa in der anglikanischen Kirche von England werden wegerklärt. In der Schweiz dokumentiert regelmässig der Religionssoziologe Jürg Stolz die negative Entwicklung. Nun hat in einem Streitgespräch der Neuen Zürcher Zeitung der Zürcher Leiter des Zentrums für Kirchenentwicklung, Thomas Schlag, Argumente für gegenläufige Trends begründet.
Hochmoderne Menschen glauben
Während Stolz seine These bestätigt sieht, dass der Gottesglaube vor allem in politisch stabilen Staaten mit hohen menschlichen Werten und guter Bildung abnimmt, widerspricht Thomas Schlag mit dem Beispiel Südkorea, wo sich in einem technisch hoch entwickelten Land das Christentum rasant ausbreite. Doch selbst im deutschsprachigen Raum gebe es eine «Tendenz in Richtung Freikirchen», wo sich Ingenieure, IT-Leute oder Kommunikationsexperten dem Glauben zuwenden. Also «hochmoderne Menschen».
Schlag nimmt in der Gesellschaft ein «gewaltiges Interesse an religiösen Fragestellungen» wahr und sagt daher gegenüber Stolz: «Wir müssen sehr viel genauer überlegen, wie wir Religion definieren.» Er stellt in Frage, dass dafür der Blick auf «Gottesdienstbesuch, Gebetspraxis und Transzendenzvorstellungen» genügt. Er verweist dagegen auf das «hohe Interesse» an theologischer Literatur und nennt als Beispiele die Bücher von Margot Kässmann und Samuel Koch. Er fordert die Religionssoziologie auf, nicht nur mit quantitativen Daten zu arbeiten, sondern das Mikroskop einzusetzen. Dann erhalte man ein Bild, das die «Vielfalt religiöser Dynamiken» zeige.
Der blinde Fleck der Religionssoziologie
Konkret erfährt es Schlag so: «Wenn ich mich irgendwo als Theologe oute, kann ich mich fasst nicht vor sinnbezogenen und religiösen Fragen retten, die man mir stellen möchte.» Da gehe es nicht nur um den Klimawandel, sondern «um das Bedürfnis nach Trost, um Erklärungen für Schicksalsschläge, um Jenseitsvorstellungen». Und er schliesst daraus: «Es gibt offensichtlich ein Bedürfnis, sich damit auseinanderzusetzen.» Und an die Adresse von Jürg Stolz: «Wenn man dies ignoriert, bekommt die religionssoziologische Theorie einen blinden Fleck.»
Ein Tipp an die Kirche
Der Leiter des Zentrums für Kirchenentwicklung schliesst aus seinen Beobachtungen: «Die Religion ist bei vielen Menschen nicht verschwunden, aber verschüttet. Man kann sie revitalisieren.» Und er erwähnt Studien über Religion bei jungen Leuten: «Bei Jugendlichen braucht es einen Trigger. Und dann legen sie los mit religiösen Fragen.»
Er gibt der Kirche den Tipp, «solche Impulse zu geben und Räume zu schaffen, in denen dies möglich ist». Den Theologiestudierenden, die ins Pfarramt gehen wollen, gebe er mit auf den Weg: «Eure Auftragsbücher sind voll. Ihr müsst nur schauen, was drin steht.» Die Kirchen hätten keinen Grund zu klagen, «weil sie eigentlich nach wie vor gefragt wären».Zum Thema:
Graham Tomlin: Wie Gemeinden in London neu belebt werden
Zwei gegenläufige Entwicklungen: Kirchgemeinden werden sich entscheiden müssen
Hoffnungsbarometer 2022: «Kirchen können den Gemeinschaftssinn wieder stärken»
Datum: 18.01.2022
Autor: Fritz Imhof
Quelle: Livenet