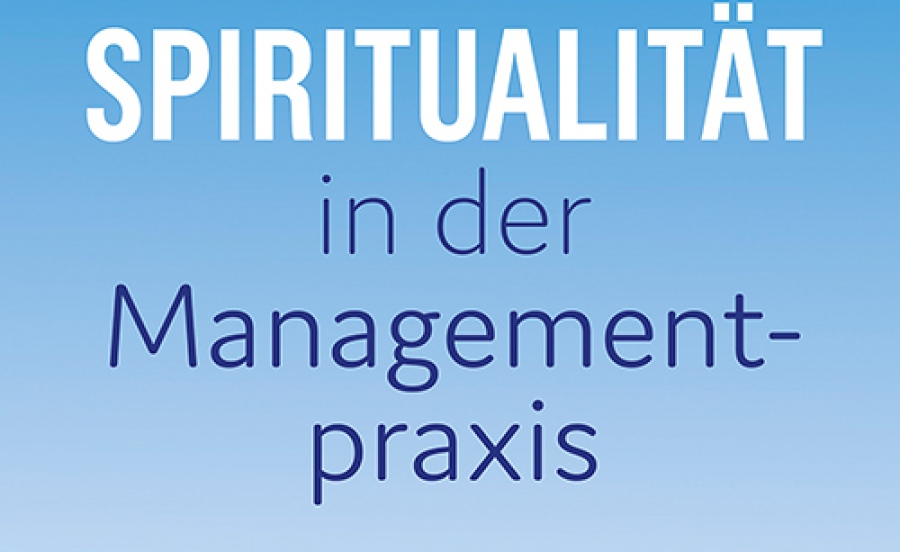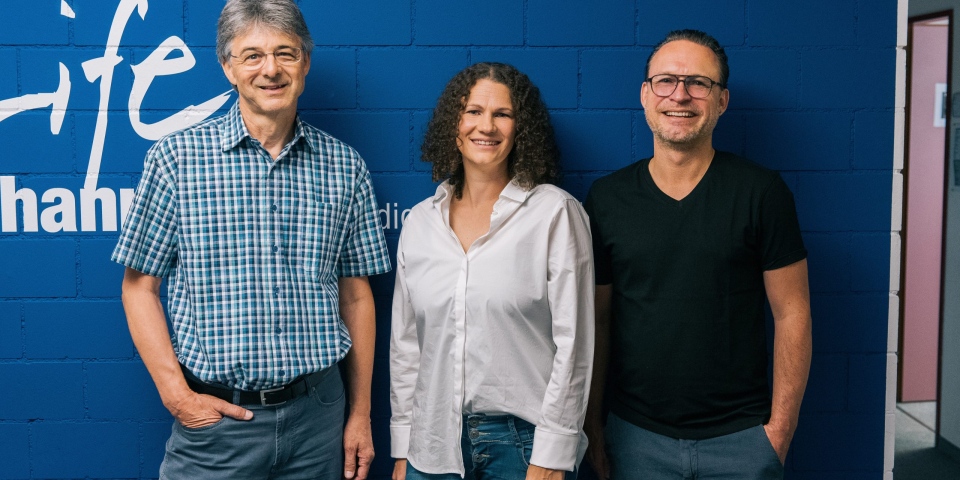«Man kann nicht am Sonntag Christ sein und am Montag Kunden belügen»
Bolsinger (46) erklärte in einem Gespräch mit Thomas Tijang vom Evangelischen Pressedienst epd: «Man kann nicht am Sonntag Christ sein und am Montag Kunden belügen und betrügen.» Und er ergänzte, er wolle «die alltägliche Schizophrenie eindämmen, die Menschen kaputtmacht».
Relevante Alltagserfahrung
Eigentlich gehört die Erfahrung, dass man sein Verhalten als Mensch und Christ nicht zwischen Montag und Sonntag trennen kann, zu dem, was einem der gesunde Menschenverstand sagt. Doch im Buch «Spiritualität in der Managementpraxis», das Bolsinger zusammen mit dem Arzt Arndt Büssing und dem Sozialwissenschaftler Markus Warode herausgegeben hat, untermauert er diese allgemeine Erkenntnis mit wissenschaftlichen Ergebnissen. Dabei leitet er seine Gewissheit allerdings nicht nur von seiner Fachkompetenz und der seiner Mitautoren ab, sondern unterstreicht gegenüber Tijang explizit, dass sie auch «aus der Begegnung mit dem christlichen Gott» herrührt. So betont er für Unternehmen, dass Gottes Offenbarungen eine Ressource im Unternehmen sein könnten, die «eine hohe Relevanz bei der Beurteilung von Situationen und Sachverhalten besitzt».
Ganzheitliches Wertemanagement
Bolsinger sieht gerade die Bergpredigt als Basis auch für unternehmerisches Handeln. Dabei unterstreicht er besonders ihr dreifaches Liebesgebot: die Liebe zu Gott, zum Nächsten und sogar zum Feind. Weitere Werte, die er für relevant hält, sind Barmherzigkeit, soziale Verantwortung oder Veränderungsbereitschaft. Die Bergpredigt ist für ihn in ihrer Kernbotschaft «weltweit und konfessionsübergreifend anerkannt».
Der Wirtschaftsethiker beschreibt seine Idee für ein ganzheitliches Wertemanagement in drei Ebenen: Zuerst nennt er die «Mindestmoral», die sogar gesetzlich eingefordert wird. Als weitere Ebene sieht er professionelles Wertemanagement. Dort geht es um Respekt, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Weltanschaulich lässt sich dies aus praktisch jeder Religion begründen. Bolsinger geht davon aus, dass diese Werte «grundsätzlich im Menschen verankert» sind und nur aktiviert werden müssen: «Alle Religionen sind gut, wenn sie die Ziele im Unternehmen fördern.» Schliesslich beschreibt er die dritte Ebene als geistliche Gemeinschaft, in der christliche Spiritualität eingeübt und gelebt wird.
Praktisch erprobt
Ähnliche Ansätze von christlichen Autoren und Pastoren gibt es immer wieder. Meist werden sie quasi von aussen an Unternehmen herangetragen: «Ich weiss, was du tun solltest …». Bolsinger geht einen gänzlich anderen Weg. Als Christ und Unternehmer kennt er wirtschaftliche Herausforderungen und Personalverantwortung aus eigener Anschauung. Trotzdem oder gerade deswegen ist Unternehmenskultur für ihn eine «zutiefst spirituelle Angelegenheit» (idea), die er am liebsten mit Gott selbst, dem «höchsten Konsultanten des Universums» bespricht. So führte er zum Beispiel in einer Nürnberger Bank ein Wertemanagementsystem ein, mit dem gesellschaftliche und soziale Verantwortung für Produkte übernommen wird. Gleichzeitig werden dort die Auswirkungen der Bankgeschäfte auf Mensch, Umwelt und regionale Wirtschaft geprüft und besonders sinnstiftende Projekte gefördert. Genau hier wird sein christlicher Wertekodex sehr konkret, denn die Bank arbeitet natürlich gewinnorientiert. Trotzdem schliesst sie Geschäfte in Bereichen wie Abtreibung, Kinderarbeit, Pornografie oder Tabak aus. Wenn man Bolsinger nach seinen Zielen fragt, dann erklärt der Wirtschaftswissenschaftler, dass es ihm darum geht, «christliche Spiritualität so [zu] übersetzen, dass sie in der monetären Welt vorstellbar ist».
Zum Thema:
Soziales Engagement: Christliche Unternehmer werden wahrgenommen
Forum christlicher Führungskräfte: Mit Gottes Hilfe gestärkt aus Niederlagen hervorgehen
Ethik: Christlicher Glaube ist gut für Wirtschaft
Datum: 09.09.2019
Autor: Hauke Burgarth
Quelle: Livenet / Sonntagsblatt