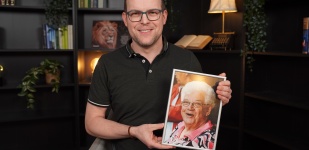Bibel, Archäologie und die Suche nach Fakten
Hinter vielen archäologischen Entdeckungen und ihrer Darstellung in den Medien steckt ein eher missionarisches Anliegen: Da geht es offensichtlich nicht darum, dass ein sensationeller Münzfund aus der Antike beschrieben wird oder man aufgrund eines ärztlichen Gutachtens von heute Fragen an die Kreuzigung von Jesus hat. Schnell wird dann der aktuelle Fund – und manchmal auch die bereits ziemlich alte Erkenntnis – ins jeweils eigene Weltbild einsortiert. Und dann ist es plötzlich klar: Diese Sensation erklärt alles! … Schön wär's.
Die Sehnsucht: Sensation und Klarheit
Dahinter steckt die heimliche Sehnsucht nach einer einfachen, griffigen und schnellen Erklärung für komplexe Zusammenhänge. Gerade in der Geschichtsforschung ist das allerdings schwierig: Die Zeiträume sind gross, die Funde gering und der Interpretationsspielraum riesig.
Befeuert wird diese Erwartungshaltung auch von einer idealisierten Geschichte der Altertumsforschung. Da gab es zum Beispiel einen der «Gründerväter» der Archäologie: Heinrich Schliemann (1822-90). Der erfolgreiche Kaufmann war fest davon überzeugt, dass Homer den trojanischen Krieg nicht erfunden hätte, rüstete eine Expedition aus, setzte eine Grabung durch und fand tatsächlich Troja. Berühmt wurde er allerdings in erster Linie durch den sensationellen «Schatz des Priamos». Doch gerade dieser Fund gehört nachweislich in eine ganz andere Zeit.
Sensation, Klarheit und Irrtum begleiten die Archäologie also schon eine ganze Weile. Aus christlicher Sicht kommt noch ein wichtiger Aspekt dazu: Wie ist in diesem Zusammenhang die Bibel zu sehen? Wie glaubwürdig ist diese alte Schriftensammlung? Und wird diese Glaubwürdigkeit von anderen Funden vielleicht noch unterstützt?
Die Realität: kleine Puzzlestücke
Vollmundigkeit bietet hier keine Lösung. Die Wissenschaft wird die Bibel nie belegen – und nie widerlegen. Tatsächlich ist insbesondere die Archäologie geradezu ein Puzzlespiel. Das geht mit vielen kleinteiligen Funden los, die zum Teil noch zusammengesetzt werden müssen. Und das geht mit ihrer Deutung weiter.
Da hat man einen Ring in Israel gefunden, auf dem der Name «Pilatus» steht. Wunderbar, auch in der Bibel kommt eine einflussreiche Person vor, die so heisst. Doch ist es dieselbe? Und was bedeutet der Fund eines Sigelrings mit seinem Namen?
Da steht in der Bibel, dass Jesus einen Blinden aufforderte, seine Augen im Teich Siloah zu waschen. Doch Archäologen wussten von keinem solchen Teich. Lange wurde die biblische Aussage deshalb als «bildlich gemeint» beschrieben, bis der Teich schliesslich entdeckt wurde.
Die Liste liesse sich fast endlos fortsetzen: Zahlreiche Funde zeigen, dass in der Bibel genannte Personen, Ereignisse und Orte Realität sind. Und zu zahlreichen biblischen Ereignissen gibt es nur die Erwähnung in der Bibel und keinerlei ausserbiblisches Zeugnis.
Der Anspruch: Glaubwürdigkeit und mehr
Jahrelang war die Bibel selbst als wissenschaftlich tragfähige Quelle für Aussagen über die Antike verpönt. Das ändert sich gerade. Inzwischen lehnt kaum ein Historiker biblische Aussagen als nicht relevant ab. Es sind für sie Quellen, genauso wie die wenigen anderen Schriften und Belege über den alten Orient.
Und eigentlich ist es auch nicht verwunderlich, dass viele biblische Aussagen nirgendwo anders als in der Bibel beschrieben werden. Geschichtsschreibung betont nämlich meistens die Positionen der Sieger, ihre Kriege und politischen Grosstaten. Da finden persönliche oder familiäre Nachrichten, wie sie in der Bibel oft vorkommen, keinen Raum.
Insgesamt ist es erstaunlich, wie viele Details und Puzzlestücke die Archäologie bislang zur biblischen Geschichte beitragen konnte. Kein Fund kann dabei für sich reklamieren, die Wahrheit der Bibel bewiesen zu haben. Aber jeder Fund ist ein Puzzlestück, das uns hilft, die Bibel und ihre Zeit besser zu verstehen.
Lässt archäologische Forschung die Bibel glaubwürdiger werden?
Das lässt sich nicht so einfach sagen. Wissenschaftliche Genauigkeit nach heutigen Massstäben war nicht das Ziel der biblischen Autoren. Auch die meisten archäologischen Funde lassen durchaus verschiedene Möglichkeiten zum Interpretieren zu. In diesem Sinne schaffen sie keine endgültige Klarheit, aber sie tragen Stück um Stück zu einem vollständigeren Bild der Bibel bei.
Die Glaubwürdigkeit der Bibel liegt auch letztlich auf einer anderen Ebene als darin zu beweisen, dass Josef tatsächlich nach Ägypten verkauft wurde. Geschichtliche Belege dafür sind wichtig und gut, doch das Anliegen der Bibel ist ein anderes: Sie will Leben vermitteln. Deshalb schliesst der Evangelist Johannes sein Evangelium auch nicht mit einem Querverweis auf andere historische Quellen, sondern mit einem Aufruf zum Glauben und Leben: «Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen» (Johannes, Kapitel 20, Vers 30-31).
Zum Thema:
Ornamentboden entdeckt: Hinweis auf Jerusalems zweiten Tempel gefunden
Geistlicher Schatz»: Moses Todesort wieder öffentlich zugänglich
Argument für die Bibel: Hier könnte Jesus Wasser in Wein verwandelt haben
Datum: 21.02.2019
Autor: Hauke Burgarth
Quelle: Livenet