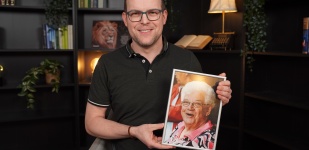Die unterschätzten Frauen der Bibel
Ein Beispiel dafür sind etliche Frauen, die im Neuen Testament genannt werden. Tabitha, Lydia, Junia und etliche andere sind hier typische Beispiele. Sie kommen im Neuen Testament vor und werden mehr oder weniger ausführlich beschrieben, spielen aber in der Theologie kaum eine Rolle.
Tabitha – die Jüngerin
Jünger ist meist ein männlicher Begriff. Aber er wird eins zu eins auf Tabitha angewandt. Die Christin aus dem heutigen Jaffa wurde von Petrus auferweckt, nachdem sie gestorben war. Das Neue Testament stellt klar, dass sie «reich [war] an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte» (Apostelgeschichte, Kapitel 9, Verse 36-43). Tabitha half Menschen in ihrem Umfeld. Robin Gallaher Branch stellt klar: «Durch die gesamte Apostelgeschichte bleibt Tabitha stumm. Lukas spricht für sie.» Der Evangelist nennt sie beim Namen als Tabitha oder Dorkas und unterstreicht damit ihren Dienst unter aramäischen und griechischen Christen. Und er bezeichnet sie aufgrund ihres Glaubens bzw. Engagements als Jüngerin.
Lydia – die Unternehmerin
Luther übersetzt ihren Beruf als Purpurkrämerin. Das hört sich mit heutigen Ohren an wie eine Hobbybeschäftigung. Doch dies liegt weit neben der Realität. Purpur war einer der wertvollsten Stoffe überhaupt, und Lydia handelte damit. Sie war im heutigen Verständnis eine Top-Unternehmerin in Thyatira. Eine Geschäftsfrau für Luxusgüter. Sie kam mit ihrem gesamten Haushalt zum Glauben. «Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu; und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam achtgab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort! Und sie nötigte uns» (Apostelgeschichte, Kapitel 16, Verse 14-15).
Tatsache ist, dass Lydia als erste Christin Europas geradezu eine Schlüsselstellung einnimmt. Obwohl sie «nur» eine Frau ist, wird sie stellvertretend für ihren gesamten Haushalt genannt. Sie ist diejenige, die das Geld verdient, und gleichzeitig öffnet sie sich für den christlichen Glauben.
Junia – die Apostelin
Noch etliche andere Frauen werden im Neuen Testament genannt, bis hin zu Junia. Im Römerbrief wird sie nur kurz in einem Gruss erwähnt: «Grüsst Andronicus und Junias, meine Verwandten und Mitgefangenen, die unter den Aposteln angesehen und vor mir in Christus gewesen sind» (Römer, Kapitel 16, Vers 7). Wird hier Junias (ein Mann) oder Junia (eine Frau) angesprochen? Scheinbar wird hier eine Frau als Apostelin bezeichnet. Tatsächlich erklärt die aktuelle Lutherbibel zusammen mit vielen anderen: «Wahrscheinlich lautete der Name ursprünglich (weiblich) Junia. In der alten Kirche und noch bis ins 13. Jahrhundert wurde er als Frauenname verstanden» (Wikipedia). Mit seinem abschliessenden Gruss im Römerbrief erklärt Paulus damit ganz nebenbei, dass Frauen damals in Gemeinden Leitungsfunktionen innehatten.
Die Frauenfrage
Wer heute auf die traditionell christliche Rolle der Frau schaut, die immer noch hauptsächlich ihre Unterordnung propagiert, vergisst leicht, dass die frühe Gemeinde extrem attraktiv für Frauen war. Der Religionssoziologe Rodney Stark weist darauf hin, dass die Stellung von Frauen im jüdisch-christlichen Kontext bedeutend besser war als im griechisch-römischen. Dort herrschte starker Männerüberschuss: In Rom kamen auf 100 Frauen 131 Männer. In Italien, Kleinasien und Nordafrika kamen sogar auf 100 Frauen 140 Männer. Diese Disbalance rührt von der Praxis her, ungewollte Mädchen zu töten oder auszusetzen.
In der frühen Kirche dagegen sah die Relation ganz anders aus. Frauen erhielten hier eine für diese Zeit besondere Wertschätzung. Christliche Frauen hatten einen besseren Stand in der Familie: Sie litten viel weniger unter Scheidung, Polygamie, Inzest und anderen gesellschaftlichen Auswüchsen, die für Christen tabu waren. Als Witwen hatten sie ihre eigene Würde und wurden nicht zur Wiederheirat gezwungen. Als erwachsene Frauen konnten sie sich für oder gegen die Ehe entscheiden und einen Partner wählen.
Dies unterschied sich deutlich von den Frauen im Römischen Reich, die sehr oft schon mit zwölf Jahren verheiratet wurden und dann bereits Kinder bekamen. Christliche Frauen hatten auch einen guten Stand in der Gemeinde – jedenfalls bis zum fünften Jahrhundert. Dort hatten sie ihre Aufgaben bis hinein in Diakonie und Leitung.
Tabitha, Lydia, Junia & Co sind typisch für Frauen in der christlichen Gemeinde. Sie passen vielleicht nicht ins gängige christliche Klischee, aber sie unterstreichen deutlich den Stellenwert, den Frauen bei Jesus und auch in den ersten Gemeinden hatten. Damals war die Kirche mit ihrem Frauenbild ein echter Trendsetter.
Zum Thema:
Frauen in der Bibel: Ist die Bibel sexistisch?
Die Kultur der Gleichberechtigung: Wie Jesus alte Traditionen ins Wanken brachte
Frauen in Leiterschaft: SEA-Präsident Wilf Gasser: «In der Praxis haben wir viel Nachholbedarf»
Datum: 14.03.2019
Autor: Hauke Burgarth
Quelle: Livenet