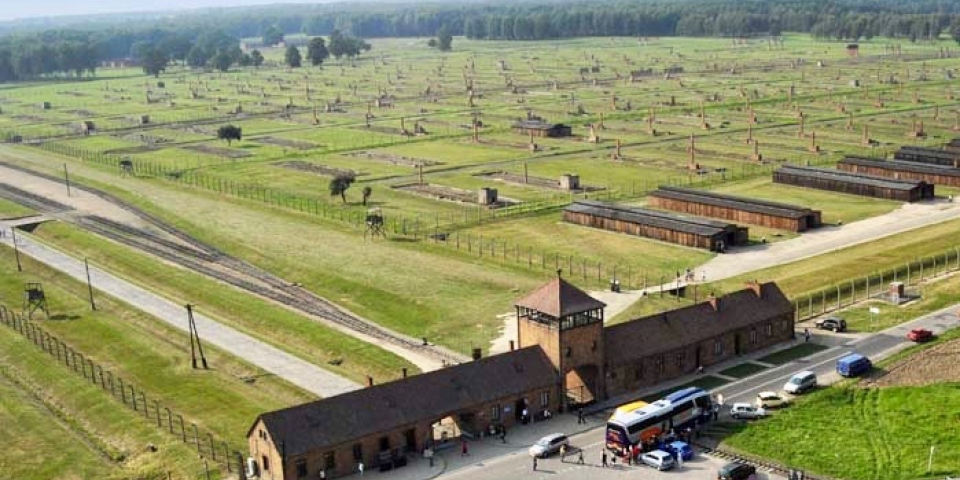Ein «aufgehender Stern» ist untergegangen
Als eine Delegation der katholischen Uni Fribourg im Herbst 2000 das russische Patriarchat besuchte, feierte sie den damaligen Priestermönch Hilarion als «aufgehenden Stern» am Moskauer Kirchenhimmel. Dabei war dieser seit der Kindheit als Musiker und bald auch als Komponist hervorgetreten und schien ganz für eine grosse künstlerische Karriere bestimmt. Während seines unerfreulichen und langen Militärdienstes vernahm Alfejew jedoch nach eigener Aussage den «Ruf Jesu». Er trat 1987 im litauischen Wilna ins Kloster ein.
Eindrückliche kirchliche Karriere
Lang hielt es ihn aber nicht in der Mönchszelle: Zwischen 1989 und 1999 heimste er theologische Doktortitel in Moskau, Oxford und Paris ein. 2002 wurde Hilarion Bischof, erst in London, dann in Wien. Er war damals zum ersten Mal für Budapest zuständig und weigerte sich dort erfolgreich gegen eine Rückgabe der von den Sowjets den Griechen geraubten Marienkathedrale.
Bei einer Diskussion mit dem Autor darüber an der Wiener Nikolaj-Kirche konnte man den stillen, romantischen Hilarion zornig schreien hören. Unser Burgfrieden wurde aber bald im russischen Kloster Neues Jerusalem bei einer Flasche Wodka, gefolgt von einem Cognac, wieder hergestellt. Zuvor hatten wir die prächtigen Handschriften der Bibliothek bewundert. Hilarion zeigte sich besonders beeindruckt, als er eine Unterschrift des einstigen Patriarchen Nikon als «Grossherrscher» entdeckte.
Jesus im Zentrum
Dieser Titel war damals für den Zaren reserviert. Hilarions Augen leuchteten auf, er schien in die eigene kirchenpolitische Zukunft zu schauen. Beim Rückflug nach Wien ging es wieder ganz um Innerlichkeit. Hilarion nannte Jesus «die Wahrheit in allen Dingen». Bald darauf wurde er beim Patriarchenwechsel von Alexi II. zu seinem Mentor Kyrill zu dessen Nachfolger an der Spitze des Kirchlichen Aussenamtes. Damit war die Zuständigkeit für alle Beziehungen zu nicht-orthodoxen Christen verbunden.
Verständnis für «Neuprotestanten»
Alfejew, der inzwischen auch in Fribourg Professsor geworden war, entwickelte diese Kontakte einseitig in Richtung katholische Kirche. Für evangelische Christen zeigte er kein Verständnis. Viele Protestanten hätten eine «lockere Version des Christentums» entwickelt, das «ohne Bindung an die christliche Moral auskommt». Von diesem Vorwurf an die «etablierten Grosskirchen» nahm er allerdings evangelische «Neuprotestanten» mit ihrer zentralen Erweckungsfrömmigkeit aus.
Das hinderte Hilarion nicht, im orthodoxen Führungsgremium «Heiliger Synod» Massnahmen gegen «ausländische Sekten» mitzutragen, worunter die meisten Freikirchen zu leiden hatten, die nicht schon lang in Russland vertreten waren. Ein wenig öffnete er sich zu diesen und empfing Ende Mai im Vorfeld seiner Absetzung den neugewählten Vorstand der «Russischen Union der Evangelischen Christen und Baptisten». Auch in einem theologischen Werk verteidigte er die Verehrung des «Namens Jesu» in der kirchlichen Frömmigkeit.
Keine Unterstützung für Putins Krieg
In die Verherrlichung von Putins Überfall auf die Ukraine durch seinen Patriarchen hat Alfejew nicht eingestimmt. Sein Schweigen war aber dem Machthaber im Kreml und seinem gefügigen Sprachrohr Kyrill nicht genug Unterwürfigkeit: Hilarion Alfejew wurde reif für den Abschuss. Zum letzten Mal war das im Mai 1960 dem damaligen Leiter des Aussenamts, Nikolaj Jaruschewitz, passiert, der sich Chruschtschow widersetzte – und dann unter verdächtigen Umständen sterben musste.
Kein ebenbürtiger Nachfolger
Der neue zweite Mann an der russischen Kirchenspitze, Antonij Sewjruk, gilt als «Apparatschik». Er verfügt weder über die Persönlichkeit noch die Bildung und religiösen Tiefgang seines Vorgängers. Sein einziges Werk ist eine Seminararbeit über die Eschatologie der Weltreligionen. Allem Evangelischen steht er völlig fremd gegenüber. Seine bisherige Laufbahn spielte sich fast immer in Rom ab.
Jetzt kann nur gehofft werden, dass Hilaron Alfejew sein Abstellgeleise in Ungarn zur Vertiefung geistlichen Lebens, besonders der Jesus-Frömmigkeit, nutzen wird. Dann hat die russische Orthodoxie – aber auch alle Evangelischen – von ihm noch Gutes zu erwarten.
Zum Thema:
Ukraine-Krieg: «Ich glaube, der Kirche in Russland droht ein baldiges Ende»
Tschetschenische Söldner: Ein «heiliger Krieg» von Muslimen und Orthodoxen
«Russland hat nie angegriffen»: Sanktionen gegen Patriarch Kyrill?
Datum: 11.06.2022
Autor: Heinz Gstrein
Quelle: Livenet