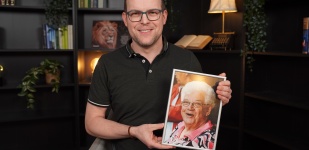Wenn die Seele den Körper hungern lässt
Um den Standards der Modebranche zu entsprechen, ernährte sie sich jahrelang fast nur von Äpfeln und Tomaten. Zuletzt wog sie bei einer Körpergrösse von 1,74 Metern gerade noch 40 Kilogramm.
Essen ist Gefühlssache
Kleine Schwankungen im Essverhalten kennen die meisten von uns. Einige setzen während den Weihnachtsfeiertagen Winterspeck an. Andere neigen dazu, in Stressphasen und Krisensituationen zu viel oder zu wenig zu essen.Vorübergehende Ausschläge bei einschneidenden Erlebnissen, wie bei dem Verlust eines geliebten Menschen oder einem anspruchsvollen Examen sind völlig normal. Nach Schätzungen reagiert die Hälfte der Bevölkerung auf gefühlsmässige Spannungen mit gesteigertem oder gezügeltem Appetit. Löst sich die seelische Unruhe, finden Betroffene in aller Regel zum gewohnten Essrhythmus zurück und der Energiehaushalt pendelt sich wieder auf dem üblichen Niveau ein.
Bei einigen Menschen verändern sich die Essgewohnheiten jedoch dauerhaft. Das Essen verliert nach und nach seinen lebenserhaltenden und genussvollen Charakter und dient zunehmend der Kompensation seelischer und zwischenmenschlicher Konflikte. Die Gedanken der Betroffenen kreisen in solchen Fällen geradezu zwanghaft um Themen wie Essen, Gewicht, Figur und Kalorienzählen. Durch das Essen beziehungsweise Nicht-Essen versuchen sie, Probleme unterschiedlichster Art zu verdrängen oder zu bewältigen. In solchen Fällen spricht man von Essstörungen.
Oft steckt mehr dahinter
Grob teilt man Essstörungen in drei Klassen ein: Magersucht, Ess-Brechsucht und Esssucht. Bei allen Erscheinungsformen handelt es sich um ernst zu nehmende und schwer zu therapierende Erkrankungen. „Essstörung" an sich beschreibt dabei nur die äusserlichen Krankheitsmerkmale. Denn die sichtbaren Schwierigkeiten sind nur Symptome tiefer liegender seelischer Konflikte. So erleben Betroffene das ständige gedankliche „Ums-Essen-kreisen" als suchtartige Verstrickung, der sie sich geradezu ohnmächtig ausgeliefert fühlen.Aufgrund dieses komplexen Krankheitsbildes ist eine gute ärztliche und therapeutische Betreuung erforderlich. Insbesondere bei Magersucht geht es darum, zunächst das Überleben des Betroffenen zu sichern und sein Gewicht zu stabilisieren. Erst anschliessend, wenn die akute Lebensgefahr vorüber ist, können seelische, familiäre und soziale Hintergrundkonflikte aufgearbeitet werden.
Ursachen und Auslöser
In den meisten Fällen löst gesellschaftlicher Druck die Krankheit aus. Die Medien verknüpfen permanent Schlankheit mit Gesundheit, Erfolg, sexueller Anziehungskraft und Glück. Vor allem Frauen denken, den mageren Vorbildern aus Hochglanz-Titeln und Hollywood entsprechen zu müssen und greifen zu Diäten.Zusätzlich erhöht wird dieser ohnehin schon starke Druck durch Hänseleien wegen der Figur seitens Familienangehöriger und Freunde. Wenn dann noch Beziehungsprobleme, Sorgen in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz dazu kommen, kann das Fass überlaufen. Gerade junge Frauen, die noch auf der Suche nach sich selbst sind, stehen in der Gefahr, auf dieserart Konflikte mit einer inneren Rebellion zu antworten. Schnell kann sich dann aus dem harmlosen Versuch, ein paar Kilo abzuspecken, eine ernst zu nehmende Erkrankung entwickeln. Eine einfache Diät war schon oft die Einstiegsdroge in die Magersucht.
So ähnlich war das auch bei Tanja. Die Studentin wuchs zusammen mit vier jüngeren Geschwistern auf. Das Klima in der Familie war meist harmonisch. Da allerdings der Vater als Geschäftsmann viel unterwegs war, konnte Tanja keine intensive Beziehung zu ihm aufbauen. Mit 15 entwickelten sich bei ihr erste magersüchtige Tendenzen, die allerdings während eines einjährigen Aufenthalts im Ausland wieder ganz verschwanden.
Als Tanja nach Deutschland zurückkam, verschlechterte sich ihr Zustand jedoch schleichend. Ab und zu passierte es, dass sie nach gewöhnlichen Mahlzeiten zwei Dutzend Eiskugeln oder ein Kilogramm Gebäck verschlang. Später erbrach sie alles wieder. Um nicht dick zu werden, landeten mehr und mehr Nahrungsmittel auf ihrem Index verbotener Speisen.
Zu dick oder zu dünn?
Dreh- und Angelpunkt magersüchtiger Menschen ist die Angst, dick zu sein oder dick zu werden. Daher sehen Betroffene in der totalen Kontrolle ihres Essverhaltens das einzige Mittel, sich vor dieser Angst zu schützen. Da es ihnen scheinbar gelingt, ihre eigenen Bedürfnisse willentlich zu bezwingen, vermittelt ihnen die Magersucht zunächst das Gefühl, etwas Besonderes zu sein oder geschafft zu haben.Hinzu kommt gerade im Anfangsstadium ein gesteigertes Selbstwertgefühl durch andere Menschen, die das Abnehmen loben. Aber nach und nach kommt es zum Kontrollverlust. Die Eigenwahrnehmung verändert sich erheblich. Betroffene fühlen sich selbst als viel zu dick, obwohl sie schon deutlich untergewichtig ist. Dieses Phänomen wird als „Körperschemastörung" bezeichnet. Objektiv wissen die Betroffenen zwar, wie dünn sie sind, fühlen aber subjektiv, dass sie viel zu dick sind.
So auch Ana Carolina Reston. Noch im April 2006, ein halbes Jahr vor ihrem Tod, bekannte das Model gegenüber einer Zeitschrift, dass sie sich mit 46 Kilogramm zu dick fühle. Dieses täuschende Gefühl ist zum Teil durch einen veränderten Hirnstoffwechsel bedingt. Menschen mit einer Essstörung können sich nicht mehr auf die inneren Signale verlassen und sind gezwungen, sich an äusseren Vorgaben zu orientieren.
Auch das Sozialverhalten verändert. Beziehungen zu Freunden, das Sozialleben oder Hobbys, spielen nur noch eine untergeordnete Rolle, ob man sich selbst und das Leben positiv wahrnimmt oder nicht. Alles wird streng an der Figur fixiert. Hinzu kommt, dass die Betroffenen versuchen, ihre Essgewohnheiten vor anderen zu verbergen. Sie verstricken sich dabei in Lügen und fühlen sich schuldig. Viele empfinden eine starke Scham. Sie hassen sich selbst und ihr Verhalten. All das treibt die Betroffenen mehr und mehr in die soziale Isolation bis hin zu Selbstmordgedanken.
Oft besteht ein Liebesdefizit
Seit 20 Jahren sind Essstörungen auf dem Vormarsch, bei Frauen wie bei Männern. Immer mehr Lehrer, Pastoren, Angehörige und vor allem Eltern begegnen Menschen, die sich zum Hunger zwingen oder völlig unkontrolliert essen. Mit einem Gefühl der Hilflosigkeit erleben sie die sich verändernden Menschen.Denn sie erfahren einerseits, dass Menschen mit Essproblemen nur schwer zugänglich sind und andererseits spüren sie als Bezugspersonen die Ohnmacht den Leidtragenden ab. Denn oft sind diese sich selbst ein Rätsel und können, ohne dass sie das wollen, Familien, Klassenverbände oder Jugendgruppen verstören.
In solchen Fällen ist es hilfreich, über Essstörungen informiert zu sein und offen darüber zu reden. Gespräche mit Betroffenen oder Angehörigen sollte man stets behutsam und nicht vorwurfsvoll führen. Aufmerksames Zuhören ist hier gefragt! Denn Betroffene zeigen meist keine Einsicht und versuchen, ihre Essprobleme herunterzuspielen oder zu verleugnen.
Brücken des Vertrauens
Um dennoch helfen zu können, kommt es darauf an, Brücken des Vertrauens zu bauen. Verzichten Sie dabei vor allem auf altkluge Ratschläge wie „Iss doch wieder!". Reden Sie lieber offen und vorwurfsfrei! Das nimmt den Magersüchtigen die Scham über ihren Zustand. Meist sind sie durch ein Liebesdefizit Getriebene und nehmen eine aufrichtige Wertschätzung dankbar an.Die Frage, was sich Magersüchtige während ihrer Krankheit am meisten von ihren Eltern und Freunden gewünscht hätten, wurde einmal von dem Magazin „Psychologie heute" wie folgt beantwortet: „Sprich mich nicht auf Essen, Gewicht und Figur an ..., sondern frage mich lieber, wie es mir geht." Und selbst wenn Betroffene konkrete Unterstützung ablehnen sollten, kann es helfen, sie mit Büchern und Adressen von Therapieeinrichtungen zu versorgen. So können sie später, wenn der Leidensdruck wieder einmal unerträglich ist, darauf zurückgreifen.
Selbstverständlich bieten auch der Glaube und die Fürbitte eine helfende Ressource. Gerade im Gebet lässt sich Betroffenheit und Unterstützungsbereitschaft ausdrücken, ohne die Betroffenen zu bedrängen. Und Fürbitte vermag viel, wenn sie ernst gemeint ist (Die Bibel, Jakobus, Kapitel 5, Vers 16). Jenseits wissenschaftlicher Überprüfbarkeit habe ich es schon oft erlebt, wie Veränderungen in der „umbeteten" seelsorgerlichen und therapeutischen Begleitung geschehen, die an ein Wunder grenzen.
Autor: Ron Kupsch
Datum: 25.03.2009
Quelle: Neues Leben